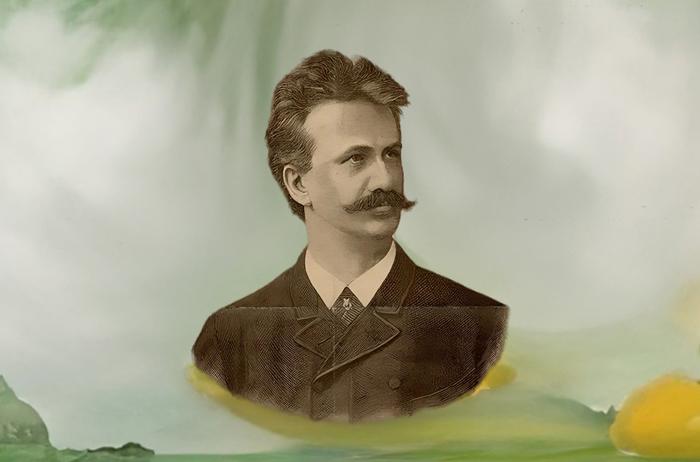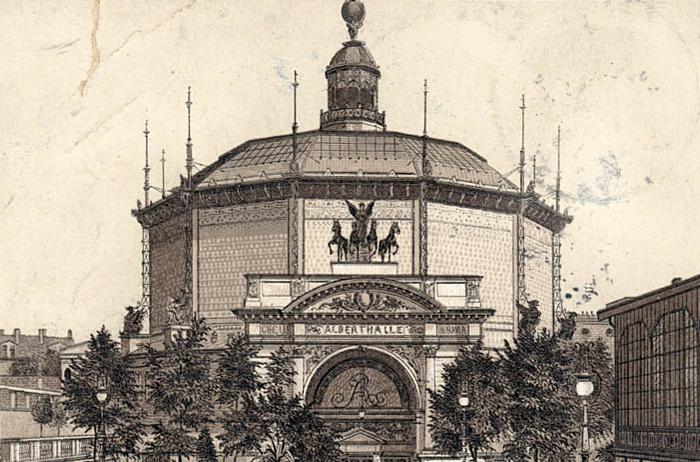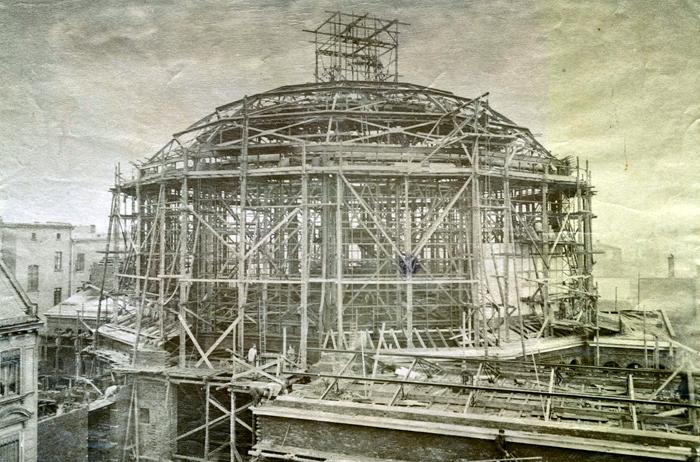Gespräch mit Experten – Peter Benecken über die Parks in den 90er Jahren
Peter Benecken ist Experte für Gartendenkmalpflege und als Stadtbezirkskonservator mitverantwortlich für den Erhalt historischer Park- und Gartenanlagen der Stadt Leipzig. Mit fundiertem Wissen über Landschaftsarchitektur und denkmalschutzrelevante Fragen bewertet er historische Grünflächen, begleitet Restaurierungen und Bauvorhaben. Im Gespräch gibt er Einblicke in die Entwicklung der Leipziger Parks seit den 1990er Jahren, insbesondere in den Jahren nach der Wende, berichtet über den Palmengarten und erklärt, warum der Erhalt denkmalgeschützter Freiräume weit mehr ist als das Bewahren der Vergangenheit für die Zukunft. Herr Benecken, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie arbeiten bei der Denkmalpflege in Leipzig. Können Sie uns zunächst etwas über Ihre Rolle und Ihre Arbeit berichten? Ich habe an der TU Berlin Landschaftsplanung (Landschaftsarchitektur) studiert und bin in der hiesigen Denkmalschutzbehörde für gartendenkmalpflegerische Belange zuständig. Das heißt, ich berate öffentliche und private Vorhabenträger und Antragsteller hinsichtlich aller Maßnahmen, welche auf denkmalgeschützten Freiflächen geplant sind. Ziel sind der Erhalt der denkmalrelevanten Substanz sowie des denkmalpflegerisch intendierten Erscheinungsbildes. Ist ein Vorhaben genehmigungsfähig, stelle ich im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung aus oder verfasse eine Stellungnahme in einem Baugenehmigungsverfahren. Denkmalrelevante Substanz sind insbesondere die Vegetationsstrukturen einschließlich des Baum- und Gehölzbestandes, Wegeverläufe und –pflasterungen oder –befestigungen, künstlerische Ausstattungen wie Plastiken und Skulpturen, Brunnen, Teiche, Bassins und andere Gewässerstrukturen sowie bauliche Strukturen wie Freitreppen, Stützmauern, Einfriedungen, Terrassen, Pavillons und Lauben, aber auch Bänke oder Beleuchtungskörper / Laternen. Nicht nur diese Substanz steht im Fokus, sondern insbesondere auch gestalterische Gefüge, Raumstrukturen und Sichtbezüge oder –achsen. Zuständig bin ich für geschätzt 4000 Objekte mit gartendenkmalpflegerischem Belang in Leipzig, darunter beinahe alle großen Park- und Friedhofsanlagen, und Stadtplätze, viele Villengärten und Eingrünungen älterer Wohnanlagen bis hin zu als Sachgesamtheiten erfassten Siedlungen oder historischen Krankenhausgeländen, aber auch zahlreiche Vorgärten. Inhaltliche Abstimmungen sind nicht nur mit dem Denkmalfachamt, dem Landesamt für Denkmalpflege, zu führen, sondern innerhalb der Stadtverwaltung insbesondere mit dem Amt für Stadtgrün und Gewässer, der Naturschutzbehörde, dem Stadtplanungsamt oder dem Verkehrs- und Tiefbauamt. Selbstverständlich gibt es auch zahlreiche Schnittmengen mit der Baudenkmalpflege, bereits dann, wenn Sanierungsarbeiten an Gebäuden mit denkmalgeschütztem Umfeld oder Garten stattfinden. In solchen Fällen sind mindestens die Bauabwicklung und Baustelleneinrichtung im Gartendenkmal abzustimmen. Wie würden Sie den allgemeinen Zustand der Parkanlagen in Leipzig in den 90er Jahren im Vergleich zu heute beschreiben? Im Verhältnis zu den baulichen Strukturen konnten zumindest in Leipzig zur Zeit der DDR die öffentlichen Park- und Grünflächen weitaus besser unterhalten werden. Dafür wurden ausreichend Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt. Dies beeinflusste den Ausgangszustand in den 1990er Jahren positiv, in denen keine schlechteren Finanz- und Pflegekapazitäten bestanden, als heute. Vielmehr unterhielt das städtische Grünflächenamt seinerzeit noch eine eigene Gärtnerei, in der Blüh- und Schmuckpflanzen herangezogen wurden. Entsprechend konnten in den 1990er Jahren noch weitaus zahlreichere Schmuckpflanzungen unterhalten werden, als derzeit. Für die verbliebenen Wechselpflanzungsflächen muss das Pflanzenmaterial heute extern beschafft werden, andere sind entfallen bzw. nun mit dauerhaften Stauden oder Wildblühstreifen besetzt. Andererseits bestanden in den 1990er Jahren verschiedentlich noch Überformungen aus der Zeit der DDR durch Einbauten wie Fernheiztrassen, Fahrspuren oder in Einzelfällen abgetrennten Flächen, etwa für das Ministerium für Staatssicherheit. Auch war die historische Gestaltung in etlichen Fällen verschliffen oder nicht erhalten. Welche Hauptprobleme oder Herausforderungen standen in der Pflege und Erhaltung der Parkanlagen in den 90er Jahren im Mittelpunkt? In den 1990er Jahren wurde bereits intensiv damit begonnen, die beschriebenen gestalterischen und strukturellen Überformungen aus der Zeit der DDR nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten zurückzubauen. Dafür konnte schon zur Zeit der politischen Wende ein eigenes Sachgebiet Gartendenkmalpflege im hiesigen Grünflächenamt geschaffen werden. In wieweit seinerzeit tatsächlich Tendenzen von Vandalismus zunahmen, wie manchmal behauptet wird, lässt sich nur schwer abschließend beurteilen, da solche Dinge zur Zeit der DDR zwar nicht verschwiegen wurden, aber den öffentlichen Diskurs zumindest weniger bestimmten. Sicher ist jedoch, dass zahlreiche Stadtteile in den 1990er Jahren von Bevölkerungsschwund, Deindustrialisierung und Leerstand betroffen waren. Jedoch wurden die dortigen Grünflächen bewusst nicht aufgegeben oder vernachlässigt, sondern weiter mehr oder weniger intensiv unterhalten, um einen ausgleichenden Impuls zu setzen. Inzwischen hat die Bevölkerung wieder stark zugenommen und flächendeckender Wohnungsleerstand ist kein Problem mehr. Entsprechend besteht die Aufgabe heute eher darin, einer zu starken Nutzung oder Übernutzung mancher öffentlichen Grünfläche entgegen zu wirken, sowie ergänzende und zeitgemäße Angebote zu schaffen. Ein schon seit einigen Jahren relevanter Aspekt ist, den Auswirkungen des Klimawandels entgegen zu wirken. So führten die zurückliegenden trockenen und heißen Jahre auch in den öffentlichen Grünanlagen zum Ausfall bzw. Absterben zahlreicher Gehölze, darunter insbesondere viele Altbäume. Betroffen sind komplette Pflanzengruppen wie alle Ahorne, welche durch klimatische Auswirkungen erst seit etwa zehn Jahren von der sog. Rußrindenkrankheit befallen werden. Bis auf Ausnahmen dürften in der Folge insbesondere Berg-Ahorne weitgehend aus dem Stadtbild verschwinden. Gleiches trifft auch auf die üblichen Hänge-Birken oder Fichten zu. Stark betroffen sind darüber hinaus Eschen und bedauerlicherweise sogar Rot-Buchen, welche zu den gestalterisch wichtigsten Gehölzen in zahlreichen Parkanlagen gehören. Konzeptionelle und denkmalpflegerische Aufgabe ist es nun, geeignete Ersatzpflanzungen zu organisieren, welche die Aufrechterhaltung der überlieferten und zu erhaltenden Parkgestaltungen erlauben. Hinsichtlich der Nutzung sind die Schaffung zusätzlicher verschatteter Bereiche oder des Angebots von Trinkwasser neue Aufgaben. Um Letzteres zu gewährleisten, wurde begonnen, Trinkbrunnen in den öffentlichen Grünanlagen zu installieren. Und im Gegensatz zu den Jahrzehnten nach 1990 werden seit einigen Jahren auch wieder öffentliche Toiletten im meist grün geprägten Stadtraum neu geschaffen und unterhalten. Gab es in den Jahren nach der Wende besondere Initiativen oder Projekte zur Verbesserung der Parkanlagen? Wie erwähnt, konnte schon zu Beginn der 1990er Jahre ein eigenes Sachgebiet Gartendenkmalpflege im damaligen Grünflächenamt geschaffen werden. Dieses organisierte bereits zu diesem frühen Zeitpunkt die Erarbeitung gartendenkmalpflegerischer Zielstellungen für die wichtigsten Parkanlagen, welche dann mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt wurden. Diese Zielstellungen sind in weiten Teilen mit den sog. Parkpflegewerken identisch und bilden die konzeptionelle Grundlage für die Unterhaltung, Sanierung und Entwicklung von Grünanlagen. Damit übernahm Leipzig eine Vorreiterrolle durchaus auch mit Blick auf das gesamte wiedervereinigte Deutschland. Schon 1993 lag entsprechend eine denkmalpflegerische Zielstellung für den gesamten Promenadenring vor, welche nunmehr, nach über 30 Jahren, überarbeitet wird. Etliche solche Planwerke für weitere Parkanlagen folgten schon im … Weiterlesen